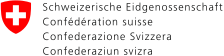Einzelne Lebensmittel stehen bisweilen im Fokus des Interesses, sei es, weil es neue Ernährungsempfehlungen gibt oder weil Inhaltsstoffe für einzelne Personen gesundheitsrelevant sein können.
In der Schweiz sind verschiedene Arten von koffeinhaltigen Getränken erhältlich. Dazu gehören beispielsweise Getränke mit Kaffee-Extrakt (wie Caffè Latte) und koffeinhaltige Süssgetränke (wie Energydrinks, Cola-Getränke usw.). Diese Getränke weisen generell einen hohen Koffeingehalt auf, enthalten – mit Ausnahme der künstlich gesüssten Produkte – aber auch viel Zucker.
Koffein
Koffein ist ein Stoff, der in Kaffee- und Kakaobohnen, Teeblättern, Guarana usw. enthalten ist. Der maximale Koffeingehalt ist in der Verordnung des EDI über Getränke geregelt, denn in sehr hohen Dosen ist der Stoff schädlich. Kurzfristig kann zu viel Koffein Schlafstörungen bewirken und Angstgefühle verstärken, langfristig kann es zu Herz-Kreislauf-Problemen führen, und bei schwangeren Frauen können negative Auswirkungen auf die Entwicklung des ungeborenen Kindes beobachtet werden. Auf Getränken mit einem Koffeingehalt über 150 mg/l muss daher der Hinweis «erhöhter Koffeingehalt, für Kinder und schwangere oder stillende Frauen nicht empfohlen» angebracht werden. Getränke, die auf Kaffee, Tee, Kaffee- oder Teeextrakt basieren, sind von dieser Pflicht ausgenommen.
Zucker
Koffeinhaltige Süssgetränke sollten nur in kleinen Mengen konsumiert werden und gehören deshalb zur obersten Stufe der Pyramide der Schweizer Ernährungsempfehlungen (Süsses, Salziges und Alkoholisches). Eine Dose eines Energydrinks (250 ml) kann beispielsweise bis zu 30 g Zucker enthalten. Dies entspricht rund 10 Würfelzuckern (ein Würfelzucker wiegt zwischen 3 und 4 g). Bei einer Person mit einem Tagesbedarf an 2000 Kilokalorien ist das bereits die Hälfte der von der WHO empfohlenen Tagesmenge an zugesetztem Zucker. Werden diese Getränke in grossen Mengen getrunken, so begünstigt dies eine Gewichtszunahme und Kariesbildung.
Koffeinhaltige Getränke mit künstlichen Süssstoffen stellen keine Alternative zu den zuckerhaltigen Getränken dar, denn die Vorliebe für den süssen Geschmack bleibt damit erhalten und bestimmte Säuren, die in diesen Getränken oft enthalten sind, schädigen die Zähne.
Empfehlungen
- Koffeinhaltige Getränke sollten mit Mass konsumiert werden, insbesondere von Personen, die empfindlich auf Koffein reagieren.
- Kindern und schwangeren oder stillenden Frauen wird vom Konsum von stark koffeinhaltigen Getränken (z. B. Energydrinks) abgeraten.
- Diese Getränke sollten nicht übermässig oder unmittelbar vor intensiver körperlicher Anstrengung getrunken werden, da dies negative Auswirkungen auf die Gesundheit haben kann.
Es gibt in der Schweiz immer mehr Geschäfte, die Spezialitätensalze wie Fleur de Sel, Himalaya, Persisches, Bambus oder Hawaii Salz verkaufen. Diese Salze werden oft als natürlicher als gewöhnliches Speisesalz angepriesen. Zudem werden ihnen spezielle gesundheitliche und ernährungsphysiologische Wirkungen zugeschrieben. Allerdings war bisher, mit Ausnahme ihres Gehalts an Natriumchlorid, wenig über die Zusammensetzung dieser Salze bekannt. Aus diesem Grund hat das BLV 25 in der Schweiz erhältliche Salze analysiert.
Die Analyse hat bestätigt, dass alle getesteten Salze hauptsächlich aus Natriumchlorid bestehen. Die meisten weiteren Elemente wie Jod, Eisen oder Zink sind nur in Spuren oder gar nicht zu finden. Die Untersuchung zeigt klar, dass Spezialitätensalze keine Vorteile gegenüber gewöhnlichen Speisesalzen aufweisen. Im Gegenteil, wegen ihres geringen bis inexistenten Jodgehaltes sollen Spezialitätensalze jodiertes Salz nur ausnahmsweise ersetzen.
Empfehlung
Das BLV empfiehlt, unjodierte Spezialitätensalze nicht täglich und nicht als Ersatz für jodierte Speisesalze zu verwenden. Dies gilt auch für Himalaya und Persische Salze - trotz deren relativ hoher Eisen- bzw. Kaliumgehalte.
Die wichtigsten Resultate
- Gewöhnliche Salze haben eine reinere Zusammensetzung als Spezialitätensalze und bestehen zu einem höheren Anteil ausschliesslich aus Natriumchlorid. Sie enthalten auch geringere Mengen an unerwünschten Stoffen wie zum Beispiel Aluminium, Uran oder Cadmium.
- Keines der analysierten Salze enthielt gesundheitsbedenkliche Mengen an unerwünschten Stoffen, auch wenn in den Spezialitätensalzen tendenziell höhere Mengen davon gefunden wurden als in gewöhnlichen Speisesalzen.
- Obwohl nach einem sehr breiten Spektrum an Elementen gesucht wurde, konnten allgemein nur wenige Mineralstoffe und Spurenelemente in den Salzen nachgewiesen werden. Die dem Himalaya Salz nachgesagten 84 chemischen Elemente konnten nicht bestätigt werden.
- Die meisten Mineralstoffe und Spurenelemente waren in allen Salzen nur in geringfügigen Mengen, die keine ernährungsphysiologische Bedeutung besitzen, zu finden
- Meersalz enthält von Natur aus kaum Jod und kann daher nicht als gleichwertiger Ersatz von jodiertem Salz betrachtet werden.
- Persische Salze besitzen relativ hohe Mengen an Kalium. 5 g Salz liefern einen Viertel des Tagesbedarfs an Kalium.
- In Himalaya Salzen finden sich beträchtliche Mengen an Eisen. Je rötlicher ein Salz umso mehr Eisen enthält es. 5 g Salz enthalten durchschnittlich fast einen Fünftel des Tagesbedarfs an Eisen. Es kann jedoch nur ein Bruchteil dieses Eisens aufgenommen werden.
Weitere Informationen
Für Wildfleisch gelten dieselben Empfehlungen wie für Fleisch allgemein. Eine Portion beträgt 100-120 g und 2-3 Portionen pro Woche (inkl. Geflügel und Fleischerzeugnisse) genügen. Idealerweise wird dabei zwischen den verschiedenen Fleischsorten abgewechselt. Weitere Informationen dazu finden sich in den Informationen der Schweizer Ernährungsempfehlungen.
Wenn Wild mit bleihaltiger Munition erlegt wird, die sich beim Aufprall verformt oder zersplittert, bleiben winzige Munitionsreste im geschossenen Tier übrig. Fleisch von Wildschwein, Reh und Hirsch kann deshalb zu den am höchsten mit Blei belasteten Lebensmitteln gehören.
Letzte Änderung 20.09.2024