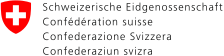Rosenhölzer sind für Madagaskar wirtschaftlich bedeutend und werden international gehandelt. Illegales Abholzen und Übernutzung bedrohen viele Arten. Mit neuen Methoden, die bei der Einfuhr in die Schweiz eine schnelle Identifizierung ermöglichen, soll der illegale Handel gestoppt werden.
«Rosenholz» oder «Palisander» sind Handelsbezeichnungen. Sie umfassen viele verschiedene Arten, die anatomisch und genetisch unterschiedlich sind und einen unterschiedlichen Schutzstatus haben. Dazu gehören Arten der Gattung Dalbergia, die infolge illegalen Abholzens und Übernutzung zum Teil stark gefährdet sind.
Viele dieser Holzarten sind in den Anhängen der «Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora» (CITES) gelistet und benötigen für den Handel Ein- und Ausfuhrdokumente. Damit sie bei Artenschutzkontrollen an der Grenze zuverlässig und schnell erkannt werden können, müssen sie eindeutig identifizierbar sind.
Das vom BLV finanzierte Forschungsprojekt «Ein molekularer Pass für madagassische Rosenhölzer» trägt zur Identifizierung der gefährdeten Arten bei und leistet damit einen Beitrag zu ihrem Schutz.
Gefährdete Tropenhölzer erkennen
Tropenhölzer der Gattung Dalbergia beinhalten wertvolle Edelhölzer, die unter anderem für Luxusartikel, wie kostbare Möbel, Schnitzereien, hochwertige Furniere, fertige Teile und Zubehör von Musikinstrumenten, verwendet werden. Dafür werden sie illegal abgeholzt und gehandelt.
Um den illegalen Handel mit den gefährdeten Arten einzuschränken, muss man sie auch in verarbeitetem Zustand erkennen können. Das heisst, auch von geschlagenen Bäumen sollen Art und Herkunft bestimmt werden können. Dies gestaltet sich bis heute schwierig.
Neue Methoden zur Artbestimmung
Im vom BLV unterstützten Forschungsprojekt wird versucht, mit drei einander ergänzenden Methoden einen molekularen Pass für Rosenholzarten zu entwickeln. Die Analyse der Variation der genetischen Eigenschaften der verschiedenen Rosenholzarten und die Analyse der chemischen Zusammensetzung des Holzes werden mit der mikroskopischen Methode zur Identifizierung der Arten kombiniert, die im Rahmen des Projekts verbessert wurde. Zusammen haben sie das Potenzial, eine Identifizierung auf Artenebene und damit einen molekularen Pass für die verschiedenen Rosenholzarten zu liefern.
Analyse der Variation genetischer Eigenschaften
Im Rahmen des Projekts wurden Daten über genetische Eigenschaften von Rosenholzarten erfasst und in einer Referenzdatenbank der ETH Zürich gesammelt. Dank benutzerfreundlichen Softwareanwendungen können die in den Datenbanken gespeicherten Analyseergebnisse auf www.tropicos.org abgefragt werden. Die Daten helfen, geschlagenes Holz einer bestimmten Art und Region zuzuordnen.
Analyse der chemischen Zusammensetzung
Mit der zweiten Methode, der Analyse der chemischen Zusammensetzung von Kernholzproben mittels massenspektroskopischer Methoden, konnten Arten genau identifiziert werden. Dies ist umso erstaunlicher, da das Kernholz, welches oft im Handel zu finden ist, wegen unzureichender DNA-Qualität häufig nicht mehr für genetische Analysen verwendet werden kann.
Mikroskopische Methode zur Artbestimmung
Die dritte Methode basiert auf der Grundlage der vergleichenden Holzanatomie mittels Mikroskopie und gilt als Kontrollmethode. Sie lieferte einen anatomischen Bestimmungsschlüssel für 16 Dalbergia-Arten, der sowohl auf Stammholz als auch auf Schnittholz angewendet werden kann. In Madagaskar kann diese Methode für die rasche Identifikation vor Ort angewendet werden.
Neue Arten beschrieben und auf die rote Liste gesetzt
Mit den neuen Analysemethoden konnten seither zwei bisher unbekannte Arten von Dalbergia spp. (Fabaceae, Leguminosae) aus dem nördlichen Madagaskar neu beschrieben werden. Der Beschrieb einer dritten Art wurde angepasst. Alle drei Arten wurden anhand von Strichzeichnungen und Fotografien illustriert. Ihr Aussterberisiko wird nach den Kriterien der Roten Liste der «International Union for Conservation of Nature (IUCN)» bewertet. Demnach werden alle drei Arten als "stark gefährdet" eingestuft und auf die rote Liste gesetzt. Weitere bereits identifizierte Arten wurden überprüft. Einige Artnahmen und Beschreibungen wurden gemäss systematischen Korrekturen angepasst. Dadurch ist die Referenzdatenbank erweitert worden.
Die neuen Methoden zur Identifizierung der Arten sind aber immer noch aufwändig und komplex und bedürfen weiterer Forschung.
Ergebnisse als Grundlage für zukünftige Schutzmassnahmen
Die Ergebnisse des Projekts werden zum Beantworten weiterer Forschungsfragen genutzt. Die Daten stehen den Arbeitsgruppen des «CITES Plant Committee», die sich mit der Identifikation von Holz beschäftigen, für wissenschaftliche Arbeiten zur Verfügung.
Die gewonnenen Informationen erlauben es den Behörden eine Einstufung der betroffenen Arten in den CITES-Anhänge vorzunehmen. Dies ist die Grundlage für zukünftige Schutzmassnahmen.
Internationale Zusammenarbeit und politische Herausforderungen
Das BLV unterstützt im Rahmen seiner Forschung ein internationales Kooperationsnetzwerk. Dazu gehört die ETH Zürich, der Missouri Botanical Garden in St. Louis / Missouri, das National Forensic Laboratory des US Fish & Wildlife Service in Ashland OR / USA und die École Supérieure des Sciences Agronomiques in Antananarivo, Madagascar.
Infolge der instabilen, politischen Situation in Madagascar war die Probengewinnung und deren Ausfuhr erschwert, da die administrativen Prozesse im Land Zeit brauchten.
Publikationen
Links
Weitere vom BLV unterstützte Forschungsprojekte für den Schutz von Rosenhölzern aus Madagaskar:
Letzte Änderung 11.04.2025