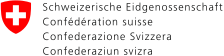Internationale Abkommen definieren und überwachen die Rahmenbedingungen für einen für Mensch und Tier sicheren internationalen Handel. Das BLV arbeitet bei technischen Anpassungen und bei der Weiterentwicklung der bestehenden Abkommen mit.
Das BLV arbeitet an einer Reihe von internationalen Abkommen mit, um die Sicherheit im internationalen Handel zu gewährleisten. Nachfolgend sind die wichtigsten Schweizer Abkommen im Veterinär-, Lebensmittel- und Artenschutzbereich aufgeführt.
Abkommen im Veterinär- und Lebensmittelbereich
Protokoll zur Lebensmittelsicherheit Schweiz-EU
Die Schweiz konnte sich mit der EU auf die Stabilisierung des Landwirtschaftsabkommens und zusätzlich zu dessen Weiterentwicklung auf ein neues Protokoll zur Lebensmittelsicherheit einigen. Der gemeinsame Lebensmittelsicherheitsraum stärkt die Gesundheit von Mensch und Tier sowie den Konsumentenschutz entlang der ganzen Lebensmittelkette. Die engere Zusammenarbeit erhöht die Sicherheit von Lebensmitteln und Agrarerzeugnissen, indem Risiken rascher identifiziert und Täuschungen effizienter bekämpft werden können. Der Handel wird durch den Abbau nichttarifärer Handelshemmnisse erleichtert. Die Schweiz erhält zudem Einsitz in EU-Gremien und damit ein aktives Mitspracherecht.
Protokoll zur Lebensmittelsicherheit Schweiz-EU
Veterinärabkommen Schweiz-EU (Landwirtschaftsabkommen Anhang 11)
Das Veterinärabkommen regelt die Bekämpfung von Tierseuchen, den Handel mit Tieren und tierischen Produkten und die Einfuhr dieser Tiere und Produkte aus Drittländern. Es bildet die Grundlage für den gemeinsamen Veterinärraum, der den Handel mit der EU erleichtert.
Veterinärabkommen Schweiz-EU.
Abkommen Schweiz-Norwegen
In diesem Abkommen anerkennen die Schweiz und Norwegen die Gleichwertigkeit der veterinärrechtlichen Vorschriften für den Handel mit Tieren und Produkten tierischer Herkunft (Veterinärabkommen Schweiz-Norwegen).
Der Geltungsbereich entspricht dem Anhang 11 des Landwirtschaftsabkommen zwischen der EU und der Schweiz (s. „Veterinärabkommen Schweiz-EU"). Somit besteht der europäische Veterinärraum offiziell aus der EU, Norwegen und der Schweiz (mit Liechtenstein).
Abkommen Schweiz-Neuseeland
In diesem Abkommen anerkennen die Schweiz und Neuseeland die Gleichwertigkeit der veterinärrechtlichen Vorschriften für den Handel mit Tieren und Produkten tierischer Herkunft (Veterinärabkommen Schweiz-Neuseeland).
Es gilt für folgende Tierarten: Rinder, Schweine, Equiden, Geflügel und Bruteier, Aquakulturen, Schafe, Ziegen und Tiere nach Richtlinie der EU 92/65/EWG. Demnach sind die Gesetzgebungen beider Länder grundsätzlich gleichwertig. Es bestehen für den Handel zwischen der Schweiz und Neuseeland, sofern dieser im Rahmen des Geltungsbereichs abgewickelt wird, die gleichen Rahmenbedingungen wie für den Handel zwischen der EU und Neuseeland.
SPS-Übereinkommen
Das Übereinkommen über die Anwendung von gesundheitspolizeilichen und pflanzenschutzrechtlichen Massnahmen (SPS-Abkommen: Sanitary and Phytosanitary Measures) enthält Regelungen über Massnahmen zum Gesundheitsschutz von Menschen und Tieren sowie von Pflanzen, die sich unmittelbar oder mittelbar auf den internationalen Handel auswirken können.
Es handelt sich um ein Abkommen der Welthandelsorganisation WTO.
Zusammenarbeit mit dem Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR)
Am 19. Juli 2016 haben das BLV und das deutsche Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) eine Absichtserklärung zur Zusammenarbeit im Bereich der Lebensmittelsicherheit unterzeichnet. Ziel ist es, Synergien zu nutzen, damit die Lebensmittelsicherheit auf der Grundlage wissenschaftlicher Stellungnahmen erhöht und die Gesundheit und Sicherheit von Konsumentinnen und Konsumenten in beiden Ländern geschützt wird. Im Rahmen der Zusammenarbeit werden mit dem BfR wissenschaftliche Erkenntnisse und Bewertungen ausgetauscht. Zudem sollen gemeinsame Veranstaltungen organisiert und gemeinsame Forschungsprojekte gefördert werden. Als erstes wurden unter andere Themen auch Antibiotikaresistenz, Rückstände in Lebensmitteln und die Bewertung von Druckfarben für eine vertiefte Zusammenarbeit ausgewählt.
Abkommen betreffend Artenschutz
CITES - Wildtiere und Wildpflanzen
CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora), auch bekannt als Washingtoner Artenschutzabkommen, ist eine internationale Handelskonvention zwischen 184 Regierungen.
Durch einen umfangreichen internationalen Handel sind viele Tier- und Pflanzenarten gefährdet oder könnten gefährdet werden. Sie sollen nur in dem Mass gehandelt werden, wie dies ihre natürlichen Bestände erlauben.
Das BLV leistet als Vollzugsbehörde von CITES einen wichtigen Beitrag zum Schutz und zur Erhaltung von Tier- und Pflanzenarten und ihren Lebensräumen. Vollzug des Artenschutz-Abkommens CITES». Grundlage für den Vollzug bietet das Bundesgesetz über den Verkehr mit Tieren und Pflanzen geschützter Arten (BGCITES) (siehe Artenschutz-Gesetzgebung).
Internationales Walfangübereinkommen (IWC)
Das Internationales Walfangübereinkommen (IWC) reguliert den Walfang weltweit. Die Wale sollen einerseits genügend geschützt werden, andererseits soll aber der Walfang ermöglicht und geregelt werden. Dem IWC gehören weltweit zurzeit 88 Mitgliedstaaten an.
Letzte Änderung 05.12.2025