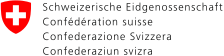Die Afrikanische Schweinepest (ASP) ist eine hochansteckende, meist tödlich endende Tierseuche bei Haus- und Wildschweinen. Seit 2007 breitet sie sich weltweit aus und tritt heute nahe der Schweizer Grenze auf. Mit seiner Ressortforschung arbeitet das BLV an einem besseren Verständnis und an Grundlagen zur Bekämpfung der ASP.
Die Afrikanische Schweinepest (ASP) ist eine hochansteckende Tierseuche mit meist tödlichem Ausgang. Sie breitet sich seit 2007 weltweit aus. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Seuche bald auch die Schweiz erreichen wird. Bis heute gibt es weder eine Behandlung noch einen Impfstoff gegen ASP. Um der Krankheit entgegenzuwirken, investiert das BLV in die Forschung. Die Ergebnisse werden bei der Umsetzung von Bekämpfungsmassnahmen von Nutzen sein.
Von menschlichen Aktivitäten gestört, können Wildschweine die Afrikanische Schweinepest verbreiten
Wildschweine dienen dem Virus der Afrikanischen Schweinepest (ASP) als Wirt. Von menschlichen Aktivitäten gestört, bewegen sie sich vermehrt auf einer grösseren Fläche und können dadurch die Seuche weiterverbreiten.
Mit der Unterstützung des BLV und des Bundesamts für Umwelt (BAFU) bewerten und priorisieren Forschende die Auswirkungen von Forst- und Freizeitaktivitäten – wie Waldspaziergänge und Laufen, Pilzsammeln, Jagd und Holzfällerei – auf das Verhalten von Wildschweinen. Dazu statten sie Wildschweine mit GPS-Halsbändern aus.

Erste Forschungsergebnisse zeigen:
- Hunde, die abseits der Wege streunen, verursachen die intensivsten Bewegungen der Wildschweine.
- Forstarbeiten verursachen in der Regel weniger Bewegungen von Wildschweinen als Aktivitäten abseits von Wegen, wie Pilzsammeln. Zu den grössten Störungen und damit Bewegungen der Wildschweine führt jedoch die Jagd.
- Die Grösse der von Wildschweinen besuchten Gebiete nimmt bei Störungen um das Zwei- bis Fünffache zu. Während der Jagd beträgt die Zunahme der Gebietsgrösse das Drei- bis Zehnfache.
- Abhängig von der Zugänglichkeit und Qualität der Ruheplätze sind Flucht- oder Versteckreaktionen zu beobachten. Aufgrund der Beobachtungen wurde die Hypothese formuliert: Wenn die Ruheplätze in begrenzter Zahl vorhanden und gut geschützt sind, flüchten die Wildschweine weniger.
- Störungen führen zu einer Erhöhung der Anzahl Ruheplätze.
- Die meisten Tiere bleiben in einem Umkreis von 3 km von ihren Ruheplätzen. Die Unterschiede zwischen den einzelnen Individuen können jedoch gross sein.
Die Erkenntnisse tragen dazu bei, die Strategie zur Bekämpfung der ASP zu verfeinern. Dies betrifft insbesondere Verhaltensregeln im Wald, die bei einem Ausbruch der Schweinepest vom Menschen befolgt werden sollten.
Grunddaten zum Forschungsprojekt über die «Auswirkungen von Forst- und Freizeitaktivitäten auf das Verhalten von Wildschweinen» und die beteiligten Forschungsinstitutionen sind auf ARAMIS unter der Projektnummer 1.21.10 ersichtlich.
Resistenzabhängige Pathogenese und Immunantwort gegen das Afrikanische Schweinepestvirus
Wie die ASP zwischen Tieren übertragen wird und welche Faktoren dabei eine Rolle spielen, untersuchten Forschende im Rahmen vom Projekt « African Swine Fever pathogenesis and immune responses in Resistant And Susceptible Hosts» ASF-RASH.
Dabei stellten sie fest, dass die Immunität der Mutter nicht ausreicht, um Ferkel vor einer tödlichen Infektion zu schützen – eine Erkenntnis, die für die Entwicklung eines Impfstoffs und die Schweinefleischindustrie wichtig ist. Ausserdem zeigte sich, dass das Virus durch künstliche Besamung auf junge Schweine übertragen werden kann, selbst wenn diese nie mit dem Virus in Kontakt gekommen sind. Dies führte zu Fehlgeburten und Infektionen bei den Embryonen.
Die Erkenntnisse helfen, das Risiko in Zuchtbetrieben besser einzuschätzen, da Ebersperma direkt nach der Entnahme verschickt wird. Das Ebersperma sollte vor dem Verschicken getestet werden.
«ASF-RASH» war Teil des europäischen Projekts ICRAD, an dem die Schweiz beteiligt ist. Dank einer Finanzierung durch das BLV hat sich das Institut für Virologie und Immunologie (IVI) des Bundes für dieses Projekt einem Konsortium von hochrangigen europäischen Forschungsinstituten angeschlossen.
Untersuchungen zur Immunpathogenese der Afrikanischen Schweinepest im Edelschwein
Die Schwere der durch ein abgeschwächtes ASP-Virus verursachten Krankheit wird von Wirtsfaktoren beeinflusst. Dies zeigten Forschende mit Untersuchungen zur Immunpathogenese der ASP im Edelschwein:
Nutzschweine und Schweine, die in einem von pathogenen Keimen freien Gebiet gezüchtet und gehalten werden (SPF-Schweine), unterschieden sich signifikant in ihrem Ausgangsimmunstatus und reagierten je nach Virulenz des Isolats unterschiedlich auf die Infektion mit ASP.
Bei hochvirulentem Virusstamm zeigten alle Tiere eine schwere Erkrankung und mussten innerhalb von 5 bis 7 Tagen nach der Infektion eingeschläfert werden. Dabei gab es keinen signifikanten Unterschied zwischen den beiden Schweinetypen. Im Gegensatz dazu zeigten SPF-Schweine bei einer Infektion mit dem abgeschwächten Virus eine mildere und kürzere klinische Erkrankung mit vollständiger Genesung. Nutzschweine erkrankten hingegen schwerer und länger, mit einer typischen Letalität von 50%.
Die Ergebnisse zeigen, dass Schweine, die in einem von pathogenen Keimen freien Gebiet gezüchtet und gehalten werden, ein vielversprechendes Modell zur Identifizierung angeborener Immun- und mikrobieller Faktoren sind, die mit der Widerstandsfähigkeit gegen Infektionen mit dem ASP-Virus in Verbindung stehen. Sie werden dazu beitragen, eine schützende adaptive Immunantwort zu identifizieren.
Interview mit Kemal Mehinagic:

Weitere Informationen
Letzte Änderung 10.04.2025