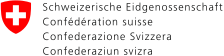Im Rahmen mehrerer, einander ergänzender Forschungsprojekte wurde der Weg des Jods nachverfolgt – vom Futter der Tiere über die Milch bis in den Käse. Klar wurde dabei: Bei den Massnahmen für eine bessere Jodversorgung der Schweizer Bevölkerung besteht noch Spielraum.
Für den Menschen ist Jod ein essenzielles Spurenelement. Ein Mangel kann insbesondere bei Kindern irreversible Schäden verursachen. Seit langem wird deshalb das Speisesalz in der Schweiz mit Jod angereichert. Trotzdem gibt es Hinweise auf eine unzureichende Jodaufnahme in der Bevölkerung, insbesondere bei Schwangeren und stillenden Müttern und ihren Säuglingen.
Neben dem jodierten Salz gehören Milch und Milchprodukte zu den wichtigsten Jodquellen in der Ernährung. Auch weil Jod aus Milch sehr gut aufgenommen wird. Da der Gehalt an Jod in Milch und Milchprodukten stark schwankt, gelten diese jedoch als nicht zuverlässige Quellen. In verschiedenen, vom BLV finanzierten Forschungsprojekten wurde deshalb geklärt, welche Faktoren die Jodkonzentration in Milch und Milchprodukten beeinflussen. Sind die wichtigsten Faktoren bekannt, können geeignete Massnahmen zur Verbesserung der Versorgung ergriffen werden.
Wovon hängt die Jodkonzentration in der Milch ab?
Die Ergebnisse der Forschungsprojekte zeigen, dass der Jodgehalt in der Milch von der Fütterung der Kühe abhängt. Durch Futtermittelzusätze kann der Jodgehalt in der Milch reguliert werden. Einzelne landwirtschaftliche Produktionsformen schränken jedoch diese Zugabe in der Fütterung ein. Weitere Faktoren, welche die Jodkonzentration in der Milch beeinflussen, sind die gleichzeitige Aufnahme von Jodantagonisten aus Futterpflanzen (etwa Thiocyanate), die Jahreszeit, aber auch das Zitzentauchen mit jodhaltigen Desinfektionsmitteln. Ebenso hat die Verarbeitung der Milch Auswirkungen auf den Jodgehalt von Milchprodukten (Aramis 5.15.01).
Wie kann der Jodgehalt im Käse erhöht werden?
In der Käseproduktion verbleibt viel Jod in der Molke, die von der Käsemasse, dem sogenannten Bruch, abgetrennt wird. Dennoch könnte Käse in der Schweiz eine wichtige Jodquelle sein. Bei der Herstellung wird der Käselaib nämlich für einige Zeit in Salzlake gebadet. Ein Forschungsprojekt konnte zeigen, dass bei Verwendung von jodiertem Salz das Jod nach und nach in den gesamten Laib eindringt und sich während der Reifung im Käselaib gleichmässig verteilt. Käse kann also auch nach dem Entfernen der Rinde bedeutend zur Versorgung mit Jod beitragen. Gegenwärtig wird jedoch in der Käseproduktion nicht jodiertes Salz verwendet. Dies verringert den möglichen Beitrag von Käse zur Jodversorgung der Bevölkerung.
.png)
Was kann das BLV tun, um die Jodversorgung der Bevölkerung zu verbessern?
Mit dem Ziel die Jodversorgung der Bevölkerung zu verbessern, wird dem Speisesalz seit bald 100 Jahren Jod beigefügt. Übermässiger Salzkonsum wirkt sich jedoch nachteilig auf den Blutdruck aus und erhöht das Risiko von Herzerkrankungen und Schlaganfällen. Deshalb rät das BLV im Einklang mit den Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation WHO zur schrittweisen Reduktion des täglichen Salzkonsums von heute durchschnittlich 9 auf 5 Gramm bei erwachsenen Personen.
Dies könnte sich aber nachteilig auf die Jodzufuhr der Schweizer Bevölkerung auswirken, da heute jodiertes Salz die wichtigste Jodquelle aus der Nahrung ist. Falls der Salzkonsum wie erwünscht zurückgeht, muss eine breitere Verwendung von Jod bei der Lebensmittelherstellung angestrebt werden. Dabei kommt der Milch und ihren Produkten eine besondere Bedeutung zu. Die vermehrte Verwendung von jodiertem Salz in der Käseproduktion könnte eine wirksame Massnahme zur Verbesserung der Jodversorgung sein.
Auch Säuglinge sind auf Jod angewiesen. Die Jodkonzentration in der Muttermilch ist bei stillenden Müttern in der Schweiz aber verhältnismässig niedrig. Aus diesem Grund unterstützt das BLV eine Studie (Aramis 4.20.03), welche die Wirkung einer Ergänzung der mütterlichen Ernährung mit Jod während der Stillzeit auf die Jodkonzentration in der Muttermilch und die Jodversorgung der Säuglinge untersucht.
Forschungsergebnisse dank Zusammenarbeit
Im Rahmen einer Dissertation wurden am Laboratorium für Humanernährung der ETH Zürich verschiedene Teilprojekte zum Jodgehalt in Milch und Milchprodukten durchgeführt. Die Forschungsinstitution Agroscope Posieux und die Gruppe für Tierernährung der ETH Zürich unterstützten die Fütterungsversuche mit den Milchkühen. Die Studien zur Saisonalität der Milchjodkonzentrationen und der Diffusion von Jod in reifenden Käselaiben wurden von den Laboratorien des BLV in Zusammenarbeit mit Agroscope Liebefeld erarbeitet.
Forschungsprojekte
Die nachfolgenden Forschungsprojekte stellen die wissenschaftlichen Grundlagen bereit, damit Milch und Ihre Produkte für die Jodzufuhr genutzt werden können. Geeignete Massnahmen, wie die Verwendung von jodiertem Salz in der Käseproduktion, lassen sich jedoch nicht kurzfristig umsetzten.
In der Käseproduktion wurde bislang nicht jodiertes Salz verwendet. Dies aufgrund der Annahme, dass der Käselaib das Jod aus jodiertem Salz im Salzbad nur begrenzt aufnimmt und das Jod in der Rinde verbleibt. Die Studie widerlegt nun diese Annahme. Die zonale Untersuchung des Jodgehaltes in ausgereiften Käselaiben ergab nämlich, dass eine gesetzmässige Diffusion von Jod bis ins Innere des Laibs erfolgt. Falls in der Käseproduktion wieder jodiertes Salz verwendet wird, bewirkt dies in der Schweiz eine mittlere Erhöhung von mehr als 10% der empfohlenen täglichen Aufnahme.
Increase of iodine content in brine-salted soft, semi-hard and hard cheeses by diffusion of iodide
Milch und Milchprodukte sind wichtige Jodquellen und für die Versorgung der Bevölkerung mit Jod ausschlaggebend. Informationen über Schwankungen der Jodkonzentration in Schweizer Milch sind begrenzt. In dieser Studie wurden potenzielle Einflussfaktoren für biologisch und konventionell erzeugte Milch in der ganzen Schweiz untersucht. Die Futtermittelkomponenten einschliesslich Wasser wurden untersucht und Informationen über Betriebsmerkmale, Fütterungs- und Desinfektionspraktiken beim Melken mittels Fragebogen gesammelt. So wurde die Jodaufnahme der Kühe im Winter und im Sommer abgeschätzt. Mineralstoffmischungen sind die Futterbestandteile, die am meisten zum Jodgehalt beitragen. Ihr Beitrag variiert aber von Jahreszeit zu Jahreszeit. (ARAMIS 5.15.01)
The main determinants of iodine in cows’ milk in Switzerland are farm type, season and teat dipping
In dieser Studie wurden Daten zur Jodkonzentration von konventionell und biologisch erzeugter UHT-Milch während eines Jahres gesammelt und mit früheren Werten verglichen. Zudem wurde der Einfluss der UHT-Behandlung auf den Jodgehalt untersucht. Schweizer UHT-Konsummilch enthält heute etwa doppelt so viel Jod wie noch vor 25 Jahren. Vermutlich ist dies eine Folge der erhöhten Futtermittelergänzungen zur Leistungssteigerung der Milchkühe. Die saisonalen Unterschiede der Jodkonzentrationen in der Milch waren sehr ausgeprägt. Im Sommer war die Jodkonzentration in der Milch tief, im Winter hoch. Bio-Milch enthielt durchschnittlich 35 % weniger Jod. Der Grund dafür ist vermutlich systembedingt. Jodierte Lecksteine sind in der biologischen Milchviehhaltung zum Beispiel verboten. Die in der Schweiz angewendeten Verfahren zur Herstellung von UHT-Milch beeinflussen den Gehalt an Jod nicht.
Die Studie untersuchte die Wirkung der Jodkonzentrationen im Futter auf die Konzentrationen in der Milch durch Supplementierung der Fütterung. Dabei wurden fünf Gruppen von je fünf Kühen mit abgestuften Dosierungen von Jod versorgt. Zudem wurden die Jodverluste bei der Herstellung von Käse und Joghurt aus Milch mit unterschiedlichen Jod-Konzentrationen erfasst. Die Ergebnisse zeigten eine lineare Beziehung der Jodkonzentrationen im Futter und in der Milch. Die Kenntnis dieses Zusammenhangs ermöglicht die Erhöhung der Jodkonzentration in Milch und Milchprodukten durch Beigabe von Jod zum Futter. Dadurch kann Milch als relevante und zuverlässige Jodquelle für die Ernährung etabliert werden. Es besteht eine Beziehung der Jodkonzentrationen in Milch und Milchprodukten. Bei der Käseproduktion geht aber ein grosser Teil des Jods mit der Molke verloren.
“Iodine in milk and dairy products in relation to iodine in feed and the contribution to iodine intake in Swiss adults” (Präsentation von Olivia van der Reijden am WFSC Rearch Symposium / ETHzürich, 08.11.2018)
(https://video.ethz.ch/events/2018/wfsc/00295543-69ad-4920-9f4b-b1be5fb6bb4e.html)
Letzte Änderung 24.05.2022